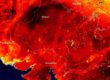Beitrag anhören 9:05 Min
Der sogenannte „Handelskrieg“ zwischen der EU und der USA geistert seit Monaten durch die Nachrichten. Viele Verhandlungen und unzählige Zeitungsberichte später war es Anfang Augst 2025 soweit – ein Deal zwischen Trump und Kommissionspräsidentin von der Leyen steht bevor.
Aber was sind Zölle eigentlich?
Ganz einfach gesagt, geht es um den Warenverkehr. Wenn eine Ware in die EU eingeführt wird, werden Zölle berechnet. Diese entsprechen den Grundregeln der WTO – der Welthandelsorganisation. Die WTO befasst sich mit den Regeln für den weltweiten Handel zwischen allen Ländern und wurde 1995 ins Leben gerufen. Ihren Sitz hat sie in Genf und setzt sich von da aus ein, einen fairen Rahmen für die Aushandlung und Umsetzung von Handelsabkommen zu schaffen, aber sie greift auch bei Handelsstreitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten ein.
Einer der wichtigsten Grundsätze, nach denen sich die EU bei der Erhebung von Zöllen richtet ist die sogenannte Meistbegünstigung. Das bedeutet, dass Länder in der Regel keine diskriminierenden Unterscheidungen zwischen ihren Handelspartnern treffen dürfen. Einige Ausnahmen sind allerdings zulässig – zum Beispiel können Länder untereinander Freihandelsabkommen schließen. Diese Abkommen gelten dann ausschließlich für Waren, die zwischen den daran teilnehmenden Ländern gehandelt werden. Die EU kann also Abkommen mit Drittländern abschließen, um Zölle zu senken und den Handel zu erleichtern. Einige der bestehenden Abkommen konzentrieren sich auf die komplette Abschaffung von Zöllen, während andere sich eher darauf beziehen, Verpflichtungen in Bereichen wie Dienstleistungen, Investitionen, Nachhaltigkeit etc. festzulegen.
Andersherum kann ein Staat aber auch Schranken gegen gewissen Produkte setzen, wenn diese aus bestimmten Ländern kommen, die als „unfair“ gelten.

Was ist der Zweck von Zöllen?
Der Hauptzweck von Zöllen ist es, lokale Unternehmen und Arbeitsplätze zu fördern und die heimische Industrie vor unlauterem Wettbewerb zu schützen. Das ist in Anbetracht der vielen Waren, die jährlich in die EU importiert, aber auch von ihr exportiert werden nicht unerheblich. Jährlich werden tatsächlich ca. 4,5 Tausend Tonnen Waren in die EU eingeführt und Waren im Wert von ungefähr 6,6 Mio. € ausgeführt.
Zölle sind vor allem beim Thema EU-Haushalt wichtig, denn sie stellen eine primäre Einkommensquelle dar. Laut Statistiken für das Jahr 2024 fließen 75% der erhobenen Zölle direkt in den EU-Haushalt, das entspricht dann ca. 13% des Gesamthaushalts. Wenn auf ein aus z.B. China eingeführtes Produkt durch die EU ein Zoll erhoben wird, entscheiden sich viele Hersteller dafür, diese Ware dann dem Zollsatz entsprechend teurer an den Endverbraucher weiterzuverkaufen.
Zollunion
In der EU gibt es eine Zollunion, welche bereits seit 1968 besteht. Diese erleichtert es Unternehmen, innerhalb der Union zu handeln. Die Zollbehörden aller EU-Staaten sollen wie eine einzige Behörde zusammenarbeiten. Auf Waren außerhalb der EU, die in eines der Mitgliedsländer eingeführt werden sollen, gibt es dann logischerweise einheitliche Zölle, während es intern keine Zollerhebungen mehr gibt. Die EU-Zollunion dient dadurch in erster Linie dem Schutz des Binnenmarkts, indem nur die Außengrenzen kontrolliert werden und der Warenverkehr in der EU uneingeschränkt möglich bleibt. Insgesamt sind die 27 EU-Staaten Teil dieses Abkommens, aber auch Staaten außerhalb der Union sind Teil – darunter Andorra, Monaco und teilweise die Türkei.
Das Handelsnetz der EU
Die Europäische Union verfügt derzeit über das größte Handelsnetz der Welt – mit 44 Abkommen mit über 70 Ländern und Regionen. Die Exportschlager der EU sind vor allem Maschinen, Fahrzeuge, Pharma- und Chemieerzeugnisse und Lebensmittel. Am meisten importiert werden Gas und Öl zur Energieversorgung, Elektrogeräte, Rohstoffe und Textilien.
Die USA und die EU – der Streit um Zölle
Beim Thema Zölle und Abkommen zwischen der USA und der EU kommt immer wieder der Begriff Handelskrieg auf. Dieser Begriff beschreibt eine Wirtschaftsstreitigkeit zwischen zwei Ländern. Dabei kann ein Land dann „Vergeltungsmaßnahmen“ gegen eine als unlauter wahrgenommene Handelspraktik verhängen. Das können dann erhöhte Zölle oder Einschränkungen auf bestimmte Waren und Produkte sein. Handelskriegen führen in den beteiligten Staaten meist zu höheren Kosten für die Unternehmen und die Verbraucher*innen.
Was die konkrete Situation zwischen der USA und der EU angeht, so nahm dies 2018 den Anfang. Damals haben die USA unter Trump Zölle auf Stahl und Aluminium aus der EU erhoben. Als Reaktion darauf hat die EU dann Gegenzölle auf EU-Erzeugnisse wie Motorräder und Bourbon-Whiskey eingeführt.

In seiner erneuten Amtszeit hat Trump dann eine Drohung ausgesprochen, in der er von Zöllen in Höhe von 30% auf EU-Produkte gesprochen hat. Beide Seiten haben daraufhin über ein Abkommen verhandelt, welches jetzt einen Grundtarif von 15% auf EU-Waren festlegt, die in die USA exportiert werden sollen. Dieser bezieht sich dann auch auf den Export von Autos – ein kleiner Gewinn, denn hier lagen die Zölle bisher bereits schon bei 30%. Es gibt aber auch Waren, die laut von der Leyen vom Deal ausgenommen sein werden. Dazu zählen Flugzeuge, bestimmte Chemikalien, Agrarprodukte und kritische Rohstoffe. Ursula von der Leyen betonte außerdem, dass die 15% für sie eine klare Obergrenze darstellen. Außerdem sei das Abkommen ein Ausgangspunkt, um in Zukunft die Abgaben wieder zu senken.
Weitere Aspekte des Abkommens mit der USA
Ein großer Knackpunkt sind die Zölle auf Aluminium und Stahl – diese sind bisher nicht Teil des 15% Deals. Diese Produkte sind schon länger ein Streitfall im Handel zwischen USA und EU. Die bereits 2018 erhobenen Zölle von 25% wurden in Trumps zweiter Amtszeit sogar nochmals verdoppelt. Laut US-Regierung bleiben diese 50% auch erstmal bestehen. Hier scheiterten offenbar die Gespräche zur Einigung über mögliche Zollabsenkungen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Abkommens ist, dass die EU zudem für 750 Mrd. $ Energie aus den USA kaufen wird. Zusätzlich sicherte sie außerdem Investitionen in Höhe von 600 Mrd. $ in den USA zu. Dieses Geld stünde dann der USA zur freien Verfügung – so hatte zumindest Trump diesen Deal aufgefasst. Er bezeichnete die Summe sogar als „Geschenk“. Wenn man die EU-Kommission fragt, ergibt sich ein anderes Bild. Hier ist die Rede davon, dass diese Investitionen eine Sache von Privatunternehmen sei und die EU somit kaum beeinflussen oder garantieren kann, wann und in welcher Form diese Gelder fließen werden. Es gibt auch einige Kritik an der Abmachung, vor allem die erhebliche Steigerung der EU-Ausgaben für amerikanisches Gas zur Energieversorgung und die fehlende Verträglichkeit dieses Vorhabens mit Umweltauflagen stößt auf Unbehagen.
Wie geht es weiter?
Erstmal muss das Abkommen noch von den EU-Staats- und Regierungschefs angenommen werden. Hier hagelte es ebenfalls bereits Kritik – und zwar von Ungarns Ministerpräsident Orban, dieser beklagte, dass andere Staaten wie Großbritannien bessere Deals vereinbart hätten und sagte „Präsident Trump hat Kommissionpräsidentin von der Leyen zum Frühstück verspeist.“
Aktuell kann allerdings die sogenannte „Appellinstanz“ der WTO nicht in diesen Handelsstreit eingreifen. Die Appellinstanz ist einfach gesagt das höchste Handelsgericht der Welt und ist die letzte Stufe im WTO-Streitbeilegungssystem. Sie funktioniert wie ein Berufungsgericht. Wenn ein Land z.B. gegen das Zollvorhaben eines anderen klagt und mit einem ersten Urteil der WTO nicht einverstanden ist, kommt die Appellinstanz ins Spiel. Diese ist jedoch seit Ende 2019 faktisch handlungsunfähig, weil die USA zuerst unter Trump und später unter Biden systematisch die Ernennung neuer Richter, die es in dem Berufungsgericht bräuchte, blockiert.
Fazit
Der seit 2018 schwelende Zollstreit zwischen den USA und der EU hat nun zu einem teilweisen Kompromiss geführt: Künftig gilt ein einheitlicher Grundtarif von 15 % auf viele EU-Exporte in die USA, was besonders für die Automobilbranche eine Entlastung bedeutet. Allerdings bleiben zentrale Streitpunkte – vor allem die hohen US-Zölle auf Stahl und Aluminium – ungelöst. Begleitet wird das Abkommen von milliardenschweren EU-Zusagen für Energieimporte und Investitionen, die politisch und ökologisch umstritten sind. Ob der Deal langfristig zu Entspannung führt, hängt von der weiteren Bereitschaft beider Seiten ab, Zölle zu senken und Handelskonflikte konstruktiv zu lösen.